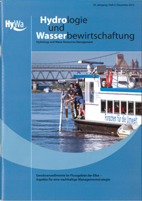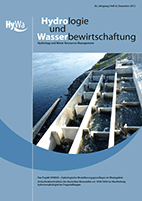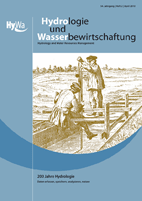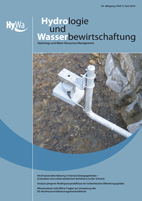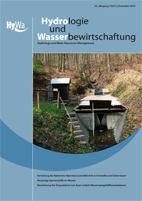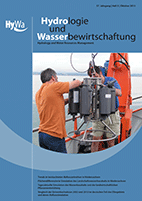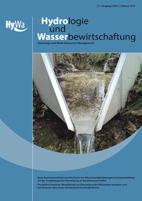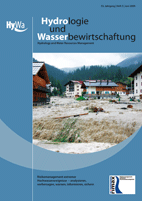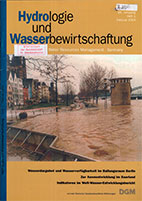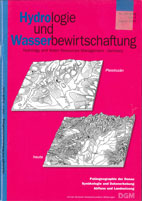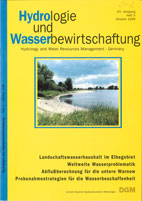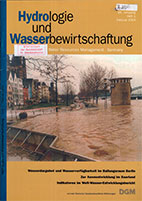
Hydrologie und
Wasserbewirtschaftung
48. Jahrgang, Heft 1,
Februar 2004
Autorin/Autor:
Walter Finke, Claudia Rachimow und Bernd Pfützner
Schlagworte:
Wasserdargebot, Wasserverfügbarkeit, GLOWA, Elbe, Wasserbewirtschaftung, globaler Wandel, Modellierung
Zitierung:
FINKE, W., C. RACHIMOW & B. PFÜTZNER (2004): Untersuchungen zu Wasserdargebot und Wasserverfügbarkeit im Ballungsraum Berlin im Rahmen des Verbundprojektes GLOWA Elbe. – Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 48 (1), 3–11
Der sich gegenwärtig abzeichnende Globale Wandel in Klima und Gesellschaft bringt eine Verunsicherung auch für die Planungsbehörden des Wassersektors mit sich. Um der durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie geforderten Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung der Wasserressourcen gerecht zu werden, müssen mögliche zukünftige Entwicklungen sowohl des Wasserdargebots als auch des Wasserbedarfs berücksichtigt werden. Jedoch sind die Komponenten des Globalen Wandels wie Klimaveränderung, Bevölkerungsentwicklung, Liberalisierung der Märkte, speziell auch für Energie, Wasser und landwirtschaftliche Erzeugnisse, sowie die Auswirkungen der EU-Erweiterung und die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie nicht exakt zu prognostizieren.
Zur Schaffung von wissenschaftlichen Grundlagen für zukünftige Planungen im Elbegebiet fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Verbundvorhaben „Auswirkungen des Globalen Wandels auf Umwelt und Gesellschaft im Elbe-Gebiet (GLOWA Elbe, Förderkennzeichen: 07 GWK 03)“. Basierend auf Szenarien für Klima und Gesellschaft einerseits und alternativen Handlungsstrategien andererseits werden Modellrechnungen durchgeführt, die es erlauben, die Auswirkungen auf Wasserdargebot, Wasserverfügbarkeit und Gewässergüte abzuschätzen.