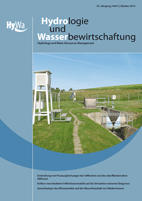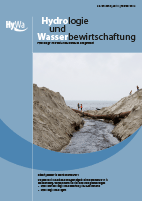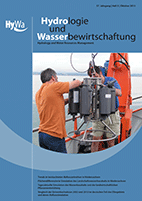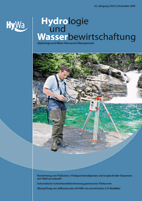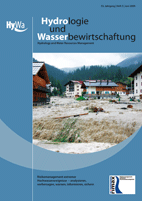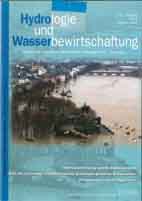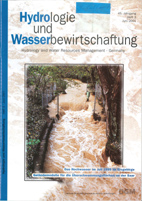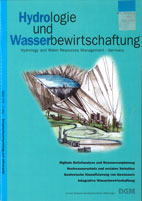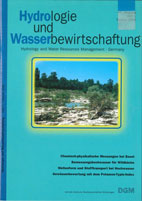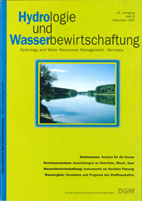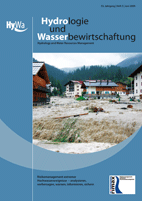
Hydrologie und Wasserbewirtschaftung
53. Jahrgang, Heft 3,
Juni 2009
Autor/Autorin:
Carsten Schmidt, Michael Wagner, Robert Schwarze, Peter Burek und Silke Rademacher
Schlagworte:
Elbe, Extremwertstatistik, Hochwasser, Klimamodell, Klimawandel, Modellunsicherheiten, Niederschlag-Abfluss-Modell, Wellenablaufmodell
Modelluntersuchungen zur Veränderung von Hochwasserscheitelabflüssen im deutschen Elbelauf unter dem Einfluss möglicher Klimaänderungen
Weltweit zeigt sich, dass natürliche Systeme bereits auf die regionalen Klimaänderungen reagieren. Dies ist eine der Hauptaussagen des 2007 veröffentlichten 4. Sachstandsberichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC). Auch das Einzugsgebiet der Elbe wird hiervon nicht unbeeinflusst bleiben. Innerhalb der BMBF-Initiative „Risikomanagement extremer Ereignisse“ (RIMAX) wurde dazu unter dem Schwerpunkt „Analysieren, Vorhersagen, Warnen“ das Forschungsvorhaben „Veränderung und Management der Risiken extremer Hochwasserereignisse in großen Flussgebieten – am Beispiel der Elbe“ (VERIS-Elbe) bearbeitet. Neben einer Modellierung der Hochwassergefahr unter Berücksichtigung von Klimaszenarien wurden in VERIS-Elbe auch die Vulnerabilität und Schadensentstehung auf der Makroskala raumzeitlich hochauflösend simuliert und Möglichkeiten des integrierten Risiko-Managements aufgezeigt.
Im Fokus des hier vorgestellten hydrologischen Teilthemas von VERIS-Elbe steht die Anwendung eines komplexen Modellsystems zur Berechnung der Veränderungen von Scheitelabflüssen extremer Hochwasserereignisse unter dem Einfluss ausgewählter zukünftiger Klimaprojektionen. Es ist zu prüfen, ob die unter dem Klimawandel meist vermutete Verschärfung der Hochwassersituation auch für das Elbeeinzugsgebiet signifikant nachgewiesen werden kann. Die Möglichkeiten und Grenzen des für das Einzugsgebiet der Elbe erprobten Modellsystems werden dabei näher erläutert. Als Ergebnis der Untersuchungen liegen Längsschnitte von Hochwasserabflüssen bestimmter Auftretenswahrscheinlichkeiten für den deutschen Elbelauf vor, welche Aussagen zur Wirkung veränderter meteorologischer Randbedingungen auf die Hochwassersituation an der Elbe ermöglichen. Die Aussagen beziehen sich dabei auf gegenwärtig vorliegende regionale Prognosen des Klimawandels.
Damit wird die Grundlage für weitergehende Untersuchungen zur Veränderung des Risikos extremer Hochwasser, z.B. für die Schadensmodellierung innerhalb von VERIS-Elbe geschaffen.