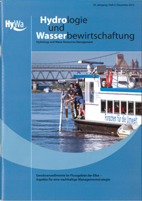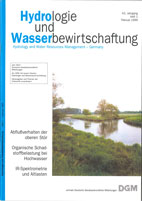Hydrologie und
Wasserbewirtschaftung
50. Jahrgang, Heft 4,
August 2006
Autorin/Autor:
Christiane Zarfl, Jörg Klasmeier und Michael Matthies
Schlagworte:
Arsen, Elbehochwasser, Mulde, inverse Modellierung, Schwebstoffe
Zitierung:
ZARFL, C., J. KLASMEIER & M. MATTHIES (2006): Modellierung von Arsen in der Mulde. – Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 50 (4), 169–177
Ausgehend vom Elbe-Hochwasser 2002, das die Frage der zusätzlichen Mobilisierung von Schwermetallen aus dem Sediment aufwarf, wurde die Normalsituation der Arsenbelastung im Einzugsgebiet der Mulde, einem Nebenfluss der Elbe, analysiert. Auf der Basis von vier Messkampagnen aus den Jahren 1992 und 1993 wurde ein datenbasiertes Massenbilanzmodell erstellt und kalibriert, das die gemessenen Arsenkonzentrationen gut abbildet. Durch inverse Modellierung konnten die Eintragsfrachten aus verschiedenen Quellen bestimmt werden. Neben einer erhöhten geogenen Hintergrundbelastung wird Arsen durch Erosion, Abschwemmung und Auslaugung aus den Halden der Bergbau- und Verhüttungsregionen des Einzugsgebietes in das Gewässer eingetragen. Die Analyse der Daten und Modellrechnungen ergab, dass so die Nebenflüsse Zschopau und das Schwarzwasser stark zur Arsenbelastung des Mulde-Hauptlaufes beitragen. Da alle vier Messkampagnen in Zeiten mit nur geringen Niederschlägen durchgeführt wurden, ist keine Aussage über einen erhöhten Eintrag durch Niederschlagsereignisse möglich. Der Muldestausee in der Vereinigten Mulde (bei Bitterfeld) stellt eine Schwebstoffsenke und somit auch eine Senke für das partikulär gebundene Arsen dar, das mit dem Schwebstoff zu 63 % im See sedimentiert. Anhand des Modells konnte gezeigt werden, dass diese Senke den beobachteten Konzentrationssprung in den Messergebnissen erklären kann. Stromabwärts von Muldenstein bewirkt eine Erhöhung des Eisengehaltes der Partikel eine verstärkte Arsensorption an den Partikeln, wodurch sich das Verhältnis zwischen partikulär gebundenem und gelöstem Arsen (ausgedrückt als Verteilungskoeffizient Kd) um eine Größenordnung erhöht (von 34 auf 388 m³/kg). Beim Vergleich der Modellergebnisse mit den gemessenen Arsenkonzentrationen fällt allerdings eine Unterschätzung der Werte in der Freiberger Mulde (v.a. in der gelösten Phase) auf. Es wird vermutet, dass hier zusätzliche, diffuse Arseneinträge stattfinden, die mit den vorliegenden Informationen und Daten noch nicht näher spezifiziert werden können. Es wurde ein Referenzszenario aus mittleren Parameterwerten erstellt, das die durchschnittlichen Arsenkonzentrationen unter Normalbedingungen im Einzugsgebiet der Mulde widerspiegelt. Ein Vergleich des Referenzszenarios mit Messergebnissen des Jahres 2003 zeigt, dass die Einträge aus den Halden über lange Zeit eine konstante Quellstärke aufweisen und sich die Situation nach dem Hochwasser wieder auf Normalbedingungen eingestellt hat. Weitere Untersuchungen, auch im Hinblick auf die Einträge bei Starkregenereignissen, benötigen eine zeitlich höher aufgelöste Datenbasis und zusätzliche Messungen in den stark belasteten Nebenflüssen.