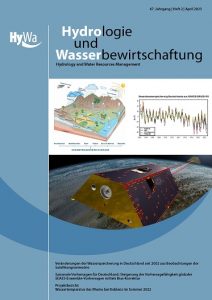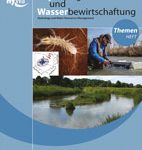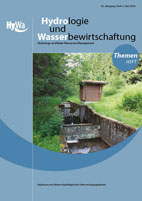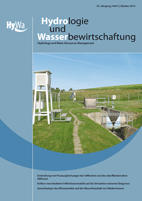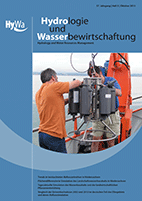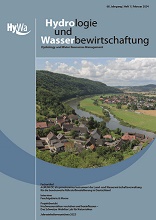
Hydrologie und
Wasserbewirtschaftung
68. Jahrgang, Heft 1
Februar 2024
Autorin/Autor:
Benjamin Schmidt, Max Eysholdt, Mareike Fischer, Peter Kreins, Astrid Krüger, Ralf Kunkel, Hong Hanh Nguyen, Björn Tetzlaff, Michael Trepel, Markus Venohr, Frank Wendland, Tim Wolters & Maximilian Zinnbauer
Schlagworte:
bundesweite Nährstoffmodellierung, Nährstoffüberschüsse, Wasserhaushalt, diffuse N- und P-Einträge, punktuelle und urbane Einträge, Retention, Frachten, AGRUM-DE
Zitierung:
Schmidt, B., Eysholdt, M., Fischer, M., Kreins, P., Krüger, A., Kunkel, R., Nguyen, H.-H., Tetzlaff, B., Trepel, M., Venohr, M., Wendland, F., Wolters, T., Zinnbauer, M. (2024): AGRUM-DE als gemeinsames Instrument der Land- und Wasserwirtschaft für die bundesweite Nährstoffmodellierung. Hydrologie & Wasserbewirtschaftung, 68, (1), 6-22.
DOI: 10.5675/HyWa_2024.1_1