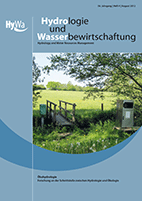Hydrologie und
Wasserbewirtschaftung
51. Jahrgang, Heft 4,
August 2007
Autorin/Autor:
Nicola Fohrer, Britta Schmalz, Filipa Tavares und Jona Golon
Schlagworte:
Drainage, Wasserhaushalt, Abflussverhalten, Modellierung, Mesoskale, Tiefland, SWAT, ökohydrologische Modellierung
Zitierung:
FOHRER, N., B. SCHMALZ, F. TAVARES & J. GOLON (2007): Ansätze zur Integration von landwirtschaftlichen Drainagen in die Modellierung des Landschaftswasserhaushalts von mesoskaligen Tieflandeinzugsgebieten. – Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 51 (4), 164–169
Der Landschaftswasserhaushalt von Einzugsgebieten des Norddeutschen Tieflands ist durch meliorative und wasserbauliche Eingriffe in starkem Maße anthropogen geprägt. Insbesondere die großräumige Drainierung landwirtschaftlicher Flächen beeinflusst
nachhaltig das Abflussverhalten und stellt einen bevorzugten Eintragspfad für Agrochemikalien in Oberflächengewässer dar. Flächendeckende Informationen zum Anteil der drainierten Flächen und deren räumliche Lage sind nicht systematisch erfasst worden,
so dass hier ein großer Unsicherheitsbereich für die ökohydrologische Modellierung entsteht. In der vorliegenden Arbeit wird ein GIS-gestütztes Verfahren zur Abschätzung der Verteilung drainierter Flächen auf der Mesoskale vorgestellt und für ein Norddeutsches
Tieflandeinzugsgebiet exemplarisch angewendet. Die Ergebnisse dieses Verfahrens werden in die ökohydrologische Modellierung mit dem Modell SWAT einbezogen, und es wird analysiert, inwieweit die Berücksichtigung der Drainageflächen die Modellierung des Landschaftswasserhaushalts verbessert.