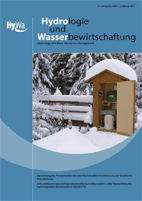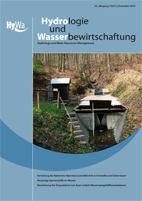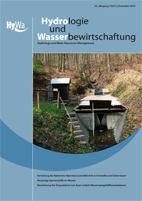
Hydrologie und Wasserbewirtschaftung
54. Jahrgang, Heft 6, Dezember 2010
Autor/Autorin:
Klaus Gocke, Jürgen Lenz, Regine Koppe, Gerhard Rheinheimer und Hans-Georg Hoppe
Schlagworte:
Ästuar, Bakterienzahl, Biomasseproduktion, Elbe, Weser
Die Mündungsgebiete von Elbe und Weser bilden die beiden größten deutschen Ästuare. Sie weisen eine Reihe von hydrologischen, geologischen und klimatischen Gemeinsamkeiten auf. Ziel der Arbeit war es zu untersuchen, ob und wieweit diese Gemeinsamkeiten auch in planktologisch/mikrobiologischer Hinsicht gelten. Hierzu wurden bei niedrigem Oberwasserabfluss im Juni 2005 Oberflächenproben in 10 km Abständen in beiden Ästuaren von ihrem limnischen Bereich bis in die Deutsche Bucht genommen. Untersucht wurden die abiotischen Parameter Temperatur, Salzgehalt, Gesamt- und Feintrübung < 2 ?m sowie die biologischen Parameter Chlorophyll a und Phäopigmente, Bakterienzahl und bakterielle Biomasseproduktion. Die biologischen Variablen hatten ihr Maximum stets in der limnischen Zone. Hier beliefen sich die Werte in der Elbe auf 10,3 ?g l-1 Chlorophyll a (Chl a), 9,5 x 109 l-1 Bakterien (BZ) und eine bakterielle Biomasseproduktion (BBP) von 4,3 ?g C l-1 h-1. In der Weser lagen sie bei 22,5 ?g l-1 (Chl a), 7,8 x 109 l-1 (BZ) und 4,1 ?g C l-1 h-1 (BBP). Ein Minimum wurde im Bereich der oberen Brackwassergrenze mit 5,2 ?g l-1 (Chl a), 5,4 x 109 l-1 (BZ) und 1,0 ?g C l-1 h-1 (BBP) in der Elbe und mit 3,8 ?g l-1 (Chl a), 7,4 x 109 l-1 (BZ) und 1,4 ?g C l-1 h-1 (BBP) in der Weser gefunden. An der seewärtigen Grenze der Ästuarregionen trat ein erneutes Maximum auf. Damit stimmten beide Ästuare sowohl in der regionalen Verteilung als auch in der Größe der Parameter weitgehend überein.