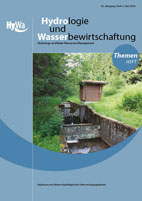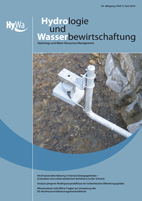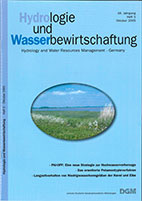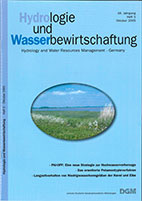
Hydrologie und
Wasserbewirtschaftung
49. Jahrgang, Heft 5,
Oktober 2005
Autorin/Autor:
Gerd H. Schmitz, Johannes Cullmann, Wilfried Görner, Franz Lennartz und Werner Dröge
Schlagworte:
Hochwasservorhersage, kleine Einzugsgebiete, Modellierung, PAI-OFF, künstliche neuronale Netze
PAI-OFF (Process Modelling and Artificial Intelligence for Online Flood Forecasting) ist eine neue Methodik, die zuverlässige Hochwasservorhersagemodelle auf dem aktuellsten Wissensstand einer Echtzeitanwendung für den operativen Einsatz zugänglich macht. Die Auflösung des Widerspruchs zwischen der rechenintensiven und anspruchsvollen Nutzung solcher Modelle und der Forderung des operativen Betriebs nach robusten, unkomplizierten und schnellen Vorhersagesystemen gelingt durch die Verbindung von hydrologisch/hydraulischen Prozessmodellen mit aufgabenspezifisch adaptierten, künstlichen neuronalen Netzen (ANN). Dazu wird zunächst auf der Basis von Beobachtungsdaten und abflussrelevanten Einzugsgebietscharakteristika ein prozessorientiertes, gekoppeltes hydrologisch/hydraulisches Modell des Einzugsgebietes erstellt. Dieses berechnet auf der Grundlage einer orttypischen meteorologischen Charakterisierung Szenarien, die alle physikalisch möglichen und sinnvollen Konstellationen der Hochwasserentstehung abdecken. Unter Ausnutzung der im Vergleich zu klassischen Niederschlags-Abflussmodellen zusätzlichen Information aus der gebietsbezogenen meteorologischen Analyse entsteht so eine Datenbank, die insgesamt die Reaktion des Einzugsgebietes auf alle Hochwasser auslösenden Niederschläge unter den unterschiedlichsten Bedingungen beschreibt. Eine auf die Problematik abgestimmte Lernstrategie überträgt diese hydrologisch/hydraulische Charakteristika des Einzugsgebiets unter Einbeziehung der hochwasserrelevanten Merkmale der Ereignis-Vorgeschichte auf das neuronale Netz. Damit überwindet PAI-OFF die entscheidende Restriktion der eingeschränkt verfügbaren Beobachtungs-(Lern)daten, an der bisherige Versuche ANN zur Hochwasservorhersage zu nutzen scheiterten. Die benannten Arbeitsschritte werden nur einmalig für ein bestimmtes Einzugsgebiet durchgeführt. Anschließend kann PAI-OFF ohne nennenswerten Aufwand routinemäßig als Werkzeug zur Hochwasservorhersage
eingesetzt werden. Dabei kommen die generellen Vorteile neuronaler Netze wie Einfachheit, Schnelligkeit, Robustheit und die Fähigkeit sich im laufenden Betrieb noch besser dem Verhalten des Einzugsgebiets anzupassen, bzw. die Auswirkung von Änderungen z.B. der Landnutzung graduell zu berücksichtigen („learning by doing“), voll zum Tragen und nutzen dabei alle Vorteile einer gewissenhaften und modernen hydraulisch/hydrologischen Modellierung. Das volle Potential von PAI-OFF ist bei der Einbeziehung von Flussabschnitten mit deutlichem Rückstaueinfluss, entsprechenden Nebenflusseinmündungen etc. oder der Einbeziehung von Unsicherheiten erst wirklich auszuschöpfen.