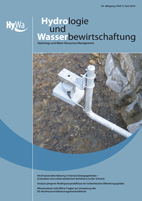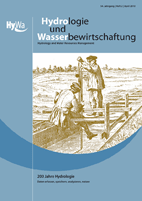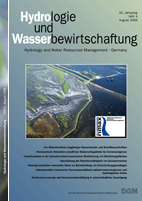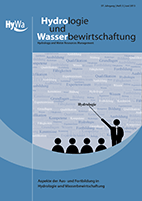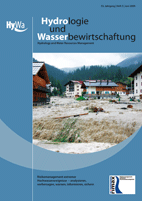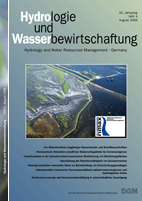
Hydrologie und
Wasserbewirtschaftung
52. Jahrgang, Heft 4,
August 2008
Autor/Autorin:
Swen Zehetmair, Jürgen Pohl, Katharina Ehrler, Britta Wöllecke, Uwe Grünewald, Sabine Mertsch, Reinhard Vogt und Yvonne Wieczorrek
Schlagworte:
Hochwasserrisikomanagement, Schwachstellenanalyse
Eines von mehr als 30 im Rahmen des RIMAX-Programmes geförderten Themen war das Projekt „Verknüpfung von Hochwasservorsorge und -bewältigung in unterschiedlicher regionaler und akteursbezogener Ausprägung“. Der Schwerpunkt dieses Projektes lag, neben der Erhöhung des Hochwasserrisikobewusstseins, in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit, bei der Betrachtung der Akteure in der Hochwasservorsorge und -bewältigung in ihrem fachlichen und regional übergreifenden Zusammenwirken. Dazu wurden zum einen empirisch-analytische Studien über rechtliche und organisatorische Aspekte sowie eine Schwachstellenanalyse des gegenwärtigen Hochwasserrisikomanagements in den Untersuchungsgebieten erstellt. Zum anderen wurden mehrere Workshops mit Experten sowie lokalen und regionalen Akteuren durchgeführt. Zusätzlich wurde eine Wanderausstellung erarbeitet und entlang der Elbe begleitet. Dieser Beitrag thematisiert ausgehend von sechs Thesen ausgewählte Probleme und Schwachstellen im Hochwasserrisikomanagement und versucht, sie anhand der Ergebnisse des Projektes zu veranschaulichen. Abschließend werden mögliche Lösungsansätze vorgestellt, die zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements beitragen können.